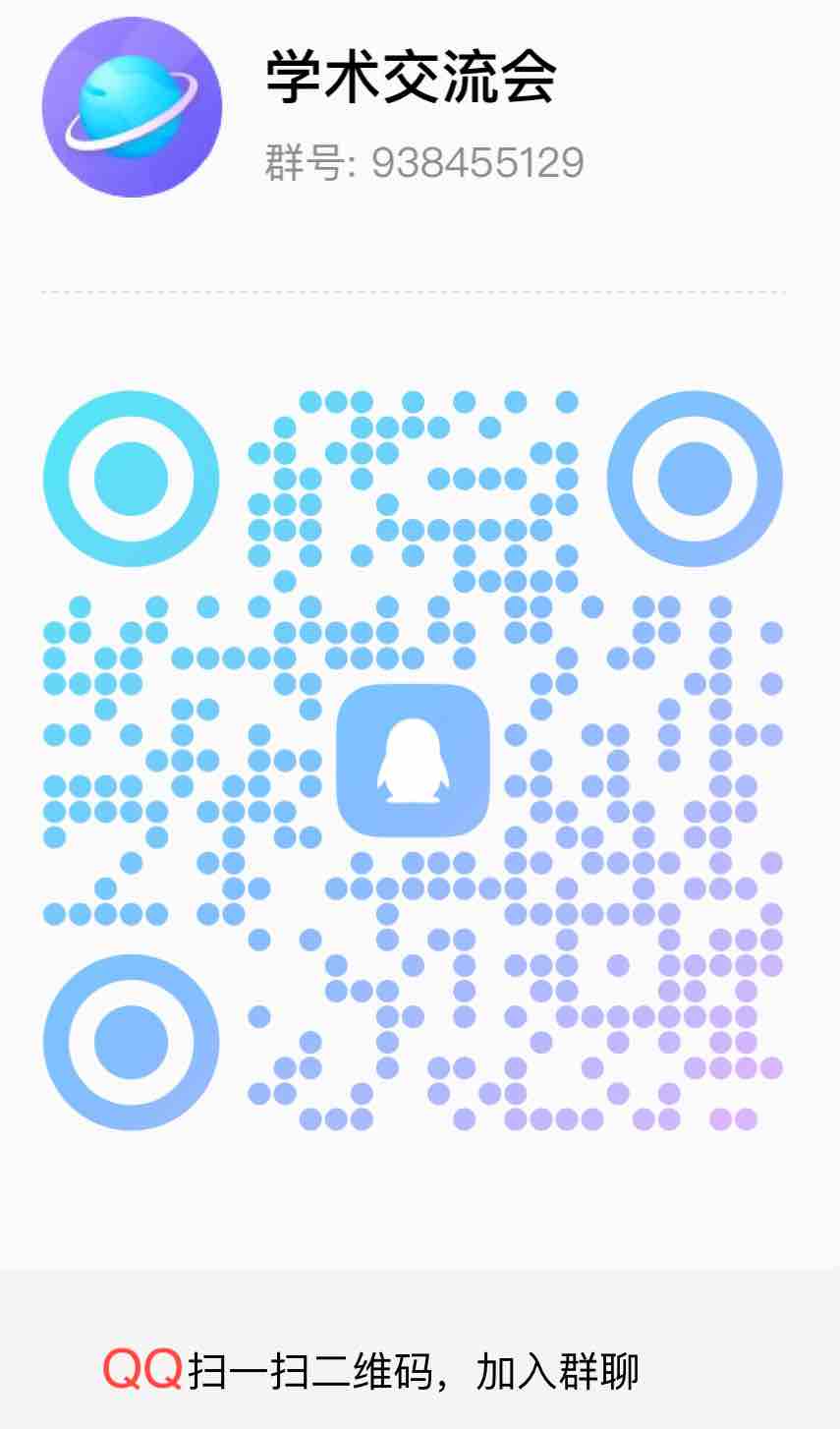Direkte, indirekte und moderierte Wirkungen von Gesundheitsbotschaften: Konzeptionelle Überlegungen und empirische Analysen
MR Hastall, AJM Wagner - … als Forschungsfeld der …, 2014 - nomos-elibrary.de
Gesundheitskommunikation als Forschungsfeld der Kommunikations-und …, 2014•nomos-elibrary.de
Die Frage, wie genau Gesundheitsbotschaften die intendierten positiven oder
unerwünschten negativen Effekte auf gesundheitsbezogene Einstellungen, Intentionen und
Verhaltensweisen der Rezipientinnen und Rezipienten bewirken, hat vielfältige theoretische
und empirische Implikationen. Lösen Botschaften ihre Effekte direkt und unvermittelt aus?
Oder gibt es wichtige zwischengeschaltete Prozesse und Randbedingungen–und falls ja,
welche sind das und auf welche Weise beeinflussen sie den persuasiven Prozess? Ein …
unerwünschten negativen Effekte auf gesundheitsbezogene Einstellungen, Intentionen und
Verhaltensweisen der Rezipientinnen und Rezipienten bewirken, hat vielfältige theoretische
und empirische Implikationen. Lösen Botschaften ihre Effekte direkt und unvermittelt aus?
Oder gibt es wichtige zwischengeschaltete Prozesse und Randbedingungen–und falls ja,
welche sind das und auf welche Weise beeinflussen sie den persuasiven Prozess? Ein …
Die Frage, wie genau Gesundheitsbotschaften die intendierten positiven oder unerwünschten negativen Effekte auf gesundheitsbezogene Einstellungen, Intentionen und Verhaltensweisen der Rezipientinnen und Rezipienten bewirken, hat vielfältige theoretische und empirische Implikationen. Lösen Botschaften ihre Effekte direkt und unvermittelt aus? Oder gibt es wichtige zwischengeschaltete Prozesse und Randbedingungen–und falls ja, welche sind das und auf welche Weise beeinflussen sie den persuasiven Prozess? Ein Blick auf einschlägige theoretische Ansätze wie beispielsweise die Protection Motivation Theory (Rogers, 1983), das Extended Parallel Process Model (Witte, 1992) oder das Transtheoretische Modell (Prochaska
& Velicer, 1997) signalisiert zunächst einen gewissen Konsens dahingehend, dass gesundheitsrelevante Botschaften typischerweise indirekt wirken. Diesen Ansätzen zufolge lösen sie zunächst bestimmte Wahrnehmungs-oder Einschätzungsprozesse aus, die ihrerseits die Ausbildung einer Intention zur Verhaltensänderung sowie deren Umsetzung fördern oder hemmen können. Indirekte Wirkungspfade erscheinen aus konzeptioneller Sicht plausibel, immerhin wurde die Annahme direkter und uniformer Medienwirkungen im Sinne eines Reiz-Reaktions-Mechanismus bereits vor Jahrzehnten als unangemessen simplifizierend verworfen (Brosius & Esser, 1998). Botschaften können natürlich durchaus automatische, unbewusste Zuwendungs-und Informationsverarbeitungsprozesse und spontane körperliche Reaktionen auslösen (z. B. Bargh & Ferguson, 2000; Donohew, Nair & Finn, 1984; Moors & De Houwer, 2006). Dass sie jedoch
nomos-elibrary.de