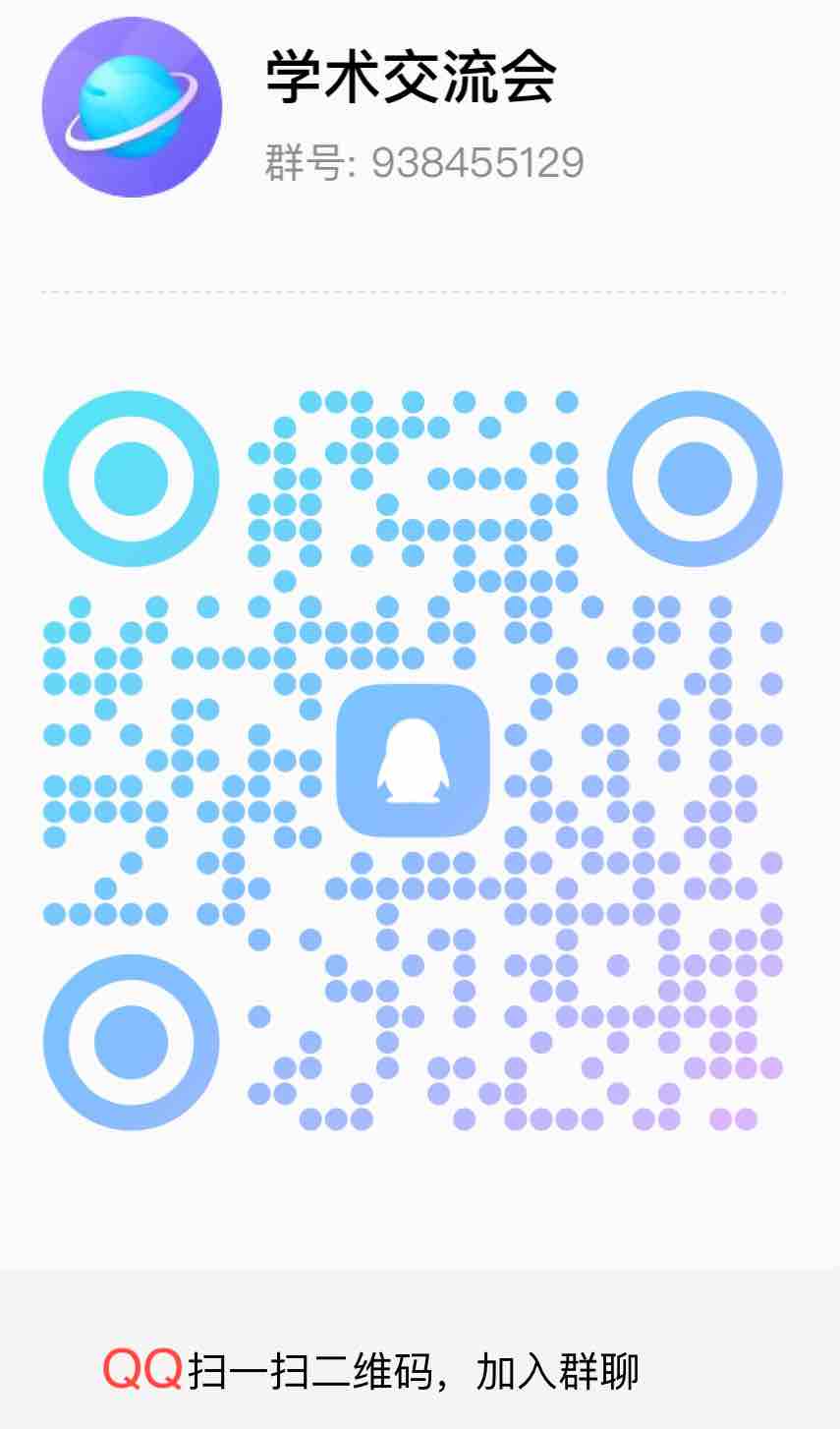[PDF][PDF] Auswirkung der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie auf Live-in-Betreuer* innen
M Leiblfinger, V Prieler, K Schwiter… - Gute Sorge ohne gute …, 2021 - researchgate.net
Gute Sorge ohne gute Arbeit, 2021•researchgate.net
Das Modell der Live-in-Betreuung in Österreich, Deutschland und der Schweiz basiert auf
überwiegend weiblichen Arbeitskräften aus mittel-und osteuropäischen Ländern, die im
Haushalt eines oder einer Senior* in (oder eines Paares) betreuen und pflegen (Bachinger
2009; Greuter/Schilliger 2010; Lutz 2005). Üblicherweise wechseln sich zwei (oder mehr)
Betreuer* innen in zwei-bis zwölfwöchigen Diensten ab und pendeln zwischen dem
Arbeitsort und ihrem Herkunftsland, zum Beispiel Polen, Rumänien oder der Slowakei …
überwiegend weiblichen Arbeitskräften aus mittel-und osteuropäischen Ländern, die im
Haushalt eines oder einer Senior* in (oder eines Paares) betreuen und pflegen (Bachinger
2009; Greuter/Schilliger 2010; Lutz 2005). Üblicherweise wechseln sich zwei (oder mehr)
Betreuer* innen in zwei-bis zwölfwöchigen Diensten ab und pendeln zwischen dem
Arbeitsort und ihrem Herkunftsland, zum Beispiel Polen, Rumänien oder der Slowakei …
Das Modell der Live-in-Betreuung in Österreich, Deutschland und der Schweiz basiert auf überwiegend weiblichen Arbeitskräften aus mittel-und osteuropäischen Ländern, die im Haushalt eines oder einer Senior* in (oder eines Paares) betreuen und pflegen (Bachinger 2009; Greuter/Schilliger 2010; Lutz 2005). Üblicherweise wechseln sich zwei (oder mehr) Betreuer* innen in zwei-bis zwölfwöchigen Diensten ab und pendeln zwischen dem Arbeitsort und ihrem Herkunftsland, zum Beispiel Polen, Rumänien oder der Slowakei. Während ihrer Dienstaufenthalte leben sie mit den Senior* innen, die sie betreuen und pflegen, unter einem Dach und sind in der Regel (nahezu) rund um die Uhr in Bereitschaft (Österle 2014; Palenga-Möllenbeck 2013; Schilliger 2014). Während Live-in-Betreuer* innen in Österreich selbstständig sind, sind sie in der Schweiz entweder direkt durch den Haushalt oder durch eine Leiharbeitsfirma angestellt. In Deutschland ist die gängigste Form die Entsendung entsprechend der EU-Richtlinie. In allen drei Ländern werden viele Betreuungskräfte durch Agenturen vermittelt, die oftmals auch für die Abwicklung der Bezahlung, den Transport und ähnliche Aufgaben zuständig sind (Chau 2020; Österle/Bauer 2016; Rossow/Leiber 2017). Live-in-Betreuung wurde in den drei Ländern, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß und durchaus nicht unumstritten, zunehmend zu einem etablierten Modell für häusliche Betreuung und Pflege (Steiner et al. 2019). Die einschlägige Literatur, welche die Arbeits-und Wohnbedingungen dieser Pflege-und Betreuungskräfte dokumentiert, offenbart die damit einhergehende Prekarität: Die Beschäftigung ist allgemein durch sehr lange Arbeitszeiten und niedrige Löhne gekennzeichnet, zudem durch eine nahezu 24-stündige Verfügbarkeit beziehungsweise Rufbereitschaft und hohe Abhängigkeit von den Arbeitgeber* in-
researchgate.net
以上显示的是最相近的搜索结果。 查看全部搜索结果